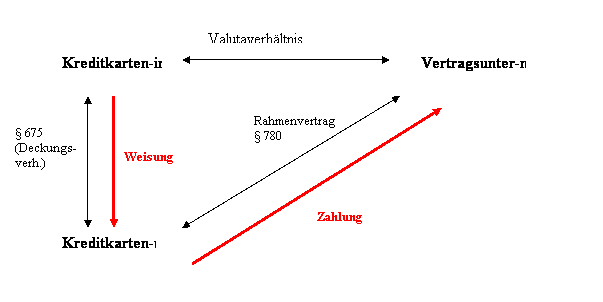Rechtsverhältnis zwischen
Kreditkartenunternehmen und Kreditkarteninhaber; Unwiderruflichkeit der
Weisung des Kreditkarteninhabers an das Kreditkartenunternehmen;
Rechtsverhältnis zwischen Kreditkartenunternehmen und Vertragsunternehmen
BGH, Urteil vom 24. September 2002 - XI ZR
420/01 - OLG Köln - LG Köln
Fundstelle:
NJW 2002, 3698
BGHZ 152, 75
Amtl. Leitsätze:
a) Die in der Unterzeichnung eines Belastungsbelegs liegende Weisung des
Kreditkarteninhabers an das Kreditkartenunternehmen, an das
Vertragsunternehmen zu zahlen, ist grundsätzlich unwiderruflich.
b) Mit der Unterzeichnung des Belastungsbelegs durch den Karteninhaber
erlangt das Vertragsunternehmen einen abstrakten Zahlungsanspruch aus §
780 BGB gegen das Kreditkartenunternehmen, dem Einwendungen aus dem
Valutaverhältnis zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen -
vorbehaltlich abweichender vertraglicher Vereinbarungen - nicht
entgegengehalten werden können. Etwas anderes gilt, wenn das
Vertragsunternehmen das Kreditkartenunternehmen rechtsmißbräuchlich in
Anspruch nimmt, weil offensichtlich oder liquide beweisbar ist, daß dem
Vertragsunternehmen eine Forderung gegen den Karteninhaber nicht zusteht.
Zentrale Probleme:
Im Mittelpunkt der Entscheidung steht das
Rechtsverhältnis zwischen dem Kreditkartenunternehmen und dem
Kreditkarteninhaber (zum Verhältnis zwischen dem Kreditkartenunternehmen
und dem Vertragsunternehmen, das die Zahlung via Kreditkarte entgegennimmt
s. die Anm. zu BGH NJW
2002, 285 sowie
BGH NJW 2002, 2234 und S
BGH, Urteil vom 13. Januar 2004 - XI ZR 479/02). Der Kl., Inhaber einer
Kreditkarte, benutzte diese zur Zahlung höherer Summen in einem offenbar
zweifelhaften Etablissement. Am nächsten morgen "widerrief" er die von ihm
unterschriebenen Zahlungsbelege gegenüber dem Kreditkartenunternehmen (die
bekl. Bank). Dieses zahlte die Beträge dennoch an den Zahlungsempfänger
(Vertragsunternehmen) aus und belastete das Konto des Klägers, der mit der
Klage diese Beträge zurückfordert.
Der BGH qualifiziert die Unterzeichnung des Belastungsbeleg nicht als
selbständige Anweisung i.S.v. §§ 783 ff BGB, sondern als (unselbständige)
Weisung innerhalb des als Geschäftsbesorgungsvertrags qualifizierten
Kreditkartenvertrags. Damit stellen die vom Kreditkartenunternehmen
ausgezahlten Beträge "Aufwendungen" (= freiwillige Vermögensopfer) des
Unternehmens dar, welche unter den Voraussetzungen der §§ 675, 670 BGB vom
Kreditkarteninhaber zu erstatten sind. Dies setzt voraus, daß es sich um
Aufwendungen handelt, die der Geschäftsbesorger "den Umständen nach für
erforderlich halten darf". Das aber darf das Kreditkartenunternehmen nicht
erst, wenn tatsächlich eine Zahlungsverpflichtung im sog. "Austausch-"
oder "Valutaverhältnis" zwischen Kreditkarteninhaber (hier: Kl.) und dem
Vertragsunternehmen (hier: das zweifelhafte Etablissement) besteht,
sondern bereits dann, wenn eine Verpflichtung zur Zahlung gegenüber dem
Vertragsunternehmen besteht.
Grafisch lassen sich die Rechtsbeziehungen
- grob vereinfacht - wie folgt darstellen:
Da mit der Unterzeichnung des Belastungsbeleg
dieses einen Anspruch aus einem abstrakten Schuldversprechen (§ 780 BGB)
gegenüber dem Kreditkartenunternehmen erwirbt (s. dazu BGH NJW
2002, 285 sowie BGH NJW 2002, 2234), kommt
auch ein Widerruf der Weisung nicht in Betracht. Das Kreditkartenunternehmen darf nur dann nicht zahlen, wenn es mangels
ordnungsgemäß zustandegekommenen Belastungsbelegs an einer
Weisung (und auch an einem Anspruch des Vertragsunternehmers aus § 780
BGB) fehlt. Deshalb prüft der BGH hier die Geschäftsfähigkeit des Kl. z.Zt. der
Unterschrift unter die Belastungsbelege.
An einem Anspruch aus § 780 BGB fehlt es
dann deshalb, weil der BGH das abstrakte Schuldversprechen dem
Rahmenvertrag zwischen Kreditkartenunternehmen und Vertragsunternehmen
entnimmt. Dieser enthalte ein durch die Einreichung ordnungsgemäß
zustandegekommener Belastungsbelege aufschiebend bedingtes (§ 158 I BGB)
abstraktes Schuldversprechen, s. BGH NJW
2002, 285.
In einem solchen Fall darf das
Kreditkartenunternehmen die in der Zahlung liegende Aufwendung nicht für
erforderlich halten.
Dasselbe gilt, wie der BGH hier bestätigt, wenn im
Valutaverhältnis eine Forderung offenbar
oder liquide beweisbar
nicht besteht. Auch in diesem Fall entsteht zwar ein Anspruch des
Vertragsunternehmens aus § 780 BGB. Dessen Geltendmachung steht auch nicht die
Bereicherungseinrede (§ 821 BGB) entgegen, weil auch im Falle des
Nichtbestehens der Zahlungsverpflichtung des Kreditkarteninhabers ein
Rechtsgrund für das abstrakte Schuldversprechen besteht. Dessen Rechtsgrund
ist nämlich nicht die Forderung im Valutaverhältnis zwischen Kreditkarteninhaber und
Vertragsunternehmen, sondern der Rahmenvertrag zwischen
Kreditkartenunternehmen und Vertragsunternehmen (zur Kondizierbarkeit des
abstrakten Schuldanerkenntnisses s. die Anm. zu
BGH
NJW 2000, 2501 sowie
BGH
NJW 2000, 2984). Das
Kreditkartenunternehmen kann (und muß) dann aber die Zahlung nach § 242 BGB
verweigern, weil
das Vertragsunternehmen das Geleistete im Wege der Leistungskondiktion an
den Karteninhaber zurückerstatten müßte ("dolo petit"-Einrede).
Bereicherungsrechtlich stellt die Zahlung
des Kreditkartenunternehmens eine "Leistung" iSv § 812 I 1 Alt. 1 BGB des
Kreditkarteninhabers an das Vertragsunternehmen, d.h. auf das
Valutaverhältnis dar (s. dazu die Anm. zu
BGH NJW 2001, 2880
und
BGH NJW 2002, 2871). Das
Kreditkartenunternehmen ist hierbei lediglich Leistungsmittler des
Inhabers. Daran ändert - wie beim echten Vertrag zugunsten Dritter - auch
die Tatsache nichts, daß das Kreditkartenunternehmen gegenüber dem
Vertragsunternehmen aus § 780 BGB zur Zahlung verpflichtet ist, also
insoweit auch auf eigene Verbindlichkeit gegenüber dem Vertragsunternehmen
leistet (s. dazu auch die Übersicht Subsidiaritätsprinzip
sowie Kurzübersicht
zu den bereicherungsrechtlichen Mehrpersonenverhältnissen).
Der BGH stützt die Entscheidung der im einzelnen sehr str. Fragen (s. dazu
die umfangreichen Literaturnachweise) materiell wiederum auf (zuvor
bereits BGH NJW
2002, 285 sowie BGH NJW 2002, 2234) den
Gedanken des Bargeldersatzes, wie er der Kreditkarte wirtschaftlich zugrundeliegt.
Die Situation des Kreditkartenunternehmens ist damit nicht zufällig
derjenigen eines Bürgen/Garanten auf erstes Anfordern vergleichbar, bei
welcher der BGH ganz ähnlich argumentiert, s. dazu die Anm. zu
BGH NJW 1999,
55 ff sowie
BGH NJW 2001, 282 ff
m.w.N.
©sl 2002
Tatbestand:
Der Kläger unterhält bei der beklagten Bank ein Girokonto und ist
Inhaber einer von ihrer Rechtsvorgängerin ausgegebenen Kreditkarte
(EUROCARD). Er verlangt Rückzahlung von Beträgen, die die Beklagte seinem
Konto aufgrund der Verwendung der Kreditkarte belastet hat.
Der Kläger unterzeichnete am 20. November 1998 zwischen 3.43 Uhr und 6.10
Uhr in einem Nachtlokal unter Verwendung der Kreditkarte neun
Belastungsbelege in Höhe von 1.000 DM, 1.200 DM, 1.200 DM, 1.600 DM, 2.000
DM, 500 DM, 3.000 DM, 5.000 DM und 2.500 DM. Nach einem kurzen Schlaf im
Hotel forderte er die Beklagte noch am Morgen desselben Tages auf, keine
Zahlungen an den Inhaber des Lokals als Vertragsunternehmer zu leisten und
sein Konto nicht zu belasten. Zur Begründung machte er geltend, er sei
"sturzbetrunken" und nicht Herr seiner Sinne gewesen. Er sei betrogen
worden und wolle Strafanzeige erstatten. Die Beklagte glich die am 23.
November 1998 vom Vertragsunternehmer vorgelegten Belege aus und belastete
das Konto des Klägers in Höhe von 18.000 DM. Das auf die Strafanzeige des
Klägers hin eingeleitete strafrechtliche Ermittlungsverfahren wurde
mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.
Das Landgericht hat die Klage auf Zahlung von 18.000 DM nebst Zinsen
abgewiesen. Das Berufungsgericht (WM 2002, 1800) hat die Berufung
zurückgewiesen. Mit der zugelassenen Revision verfolgt der Kläger seinen
Klageantrag weiter.
Entscheidungsgründe:
Die Revision ist unbegründet.
I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung im
wesentlichen ausgeführt:
Die Beklagte habe gegen den Kläger gemäß § 670 BGB einen
Aufwendungsersatzanspruch in Höhe von 18.000 DM gehabt. Aufgrund seiner
Weisungen (§ 665 BGB) in Form unterzeichneter Belastungsbelege habe sie
Zahlungen an den Vertragsunternehmer geleistet. Die Weisungen seien mit
Rücksicht auf die Bargeldersatzfunktion der Kreditkartenverwendung
grundsätzlich nicht widerruflich. Die Beklagte habe den Widerruf auch
nicht deshalb beachten müssen, weil der Kläger ihn mit der Unwirksamkeit
seiner mit dem Vertragsunternehmer geschlossenen Geschäfte und seiner mit
der Unterzeichnung der Belastungsbelege erklärten Zahlungsanweisungen
begründet habe. Da der Kläger die Behauptungen über die alkoholbedingte
Störung seiner Geistestätigkeit und die Sittenwidrigkeit der Geschäfte
nicht hinreichend belegt und trotz entsprechender Aufforderung der
Beklagten nicht schriftlich niedergelegt habe, sei die Beklagte nicht in
der Lage gewesen, gegenüber dem Vertragsunternehmer mit Aussicht auf
Erfolg Einwendungen geltend zu machen.
Dem Kläger stehe gegenüber dem Aufwendungsersatzanspruch der Beklagten
kein Leistungsverweigerungsrecht zu. Ein solches könne allenfalls in
Betracht kommen, wenn sich nachträglich Umstände ergäben, die der
Beklagten aufgrund feststehender oder leicht nachweisbarer Einwendungen
die Rückforderung ihrer Zahlungen vom Vertragsunternehmer ermöglichten.
Solche Umstände habe der Kläger aber nicht dargelegt. Eine alkoholbedingte
Geschäftsunfähigkeit gemäß § 105 Abs. 2 BGB könne nicht festgestellt
werden. Sein Vorbringen reiche nicht aus, seine mit dem
Vertragsunternehmer geschlossenen Geschäfte wegen überhöhter
Getränkepreise, wegen der Höhe der Einzelbelege oder der Gesamtbelastung
oder wegen der Inanspruchnahme und Abgeltung sexueller Leistungen als
sittenwidrig anzusehen.
II. Diese Ausführungen halten rechtlicher Überprüfung stand.
Der Kläger hat gegen die Beklagte keinen Anspruch gemäß §§ 667, 675
Abs. 1 BGB (vgl. BGHZ 121, 98, 106; Senat, Urteil vom 25. Juni 2002 -
XI ZR 218/01, WM 2002, 1683, 1685) auf Rückbuchung und Auszahlung der
seinem Konto belasteten 18.000 DM. Die Kontobelastung ist zu Recht
erfolgt, weil der Beklagten gegen den Kläger ein Aufwendungsersatzanspruch
gemäß Nr. 6 Satz 2 der von ihr verwandten "Bedingungen für den
EUROCARD-Service", die nach dem Vortrag des Klägers dem Vertragsverhältnis
zwischen den Parteien zugrunde liegen, und gemäß §§ 670, 675 Abs. 1 BGB
in Höhe des Belastungsbetrages zustand.
1. Der Vertrag zwischen einem Kreditkartenherausgeber und einem
Karteninhaber ist ein entgeltlicher Geschäftsbesorgungsvertrag, durch den
sich der Kreditkartenherausgeber verpflichtet, die Verbindlichkeiten des
Karteninhabers bei den Vertragsunternehmen zu tilgen. Kommt er dieser
Verpflichtung nach, steht ihm ein Aufwendungsersatzanspruch gemäß §§ 670,
675 Abs. 1 BGB gegen den Karteninhaber zu (BGHZ 91, 221, 223 f.).
Diese Verpflichtung des Karteninhabers wird in Nr. 6 Satz 2 der
"Bedingungen für den EUROCARD-Service" ausdrücklich hervorgehoben.
2. Der Aufwendungsersatzanspruch setzt gemäß Nr. 5 Satz 1 Spiegelstrich
1 der "Bedingungen für den EUROCARD-Service" voraus, daß der Karteninhaber
einen vom Vertragsunternehmer ausgestellten Beleg unterschreibt und dem
Kreditkartenherausgeber damit die Weisung im Sinne der §§ 665, 675 Abs. 1
BGB (BGHZ 91, 221, 224) erteilt, seine Verbindlichkeit zu tilgen. Solche
Weisungen hat der Kläger erteilt, indem er die Belastungsbelege des
Vertragsunternehmers unterzeichnet hat.
a) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, die Weisungen seien wegen der
Alkoholisierung des Klägers gemäß § 105 Abs. 2 BGB nichtig. Das
Berufungsgericht hat zwar zu diesem Nichtigkeitsgrund, bezogen auf die
Unterzeichnung der Belege, keine Feststellungen getroffen. Es hat diesen
Nichtigkeitsgrund aber für den Abschluß der durch die Verwendung der
Kreditkarte bezahlten Grundgeschäfte mit dem Vertragsunternehmer nicht
feststellen können. Dies gilt, da der Kläger die Belege gleichzeitig
mit dem Abschluß der Grundgeschäfte unterzeichnet hat, auch für die
Erteilung der Weisungen im Sinne der §§ 665, 675 Abs. 1 BGB. Die gegen
diese tatrichterliche Feststellung erhobenen Rügen der Revision hat der
Senat geprüft und nicht für durchgreifend erachtet. Von einer Begründung
wird gemäß § 565 a ZPO a.F. abgesehen.
b) Der Kläger hat die Weisungen nicht wirksam widerrufen, indem er die
Beklagte, noch bevor ihr der Vertragsunternehmer die Belege zur Vergütung
vorlegte, zur Zahlungsverweigerung aufforderte.
aa) Ob ein Karteninhaber seine in der Unterzeichnung eines
Belastungsbelegs liegende Veranlassung des Kreditkartenherausgebers zur
Zahlung bis zur Vorlage des Belegs durch das Vertragsunternehmen bei dem
Kreditkartenherausgeber widerrufen kann, wird in der instanzgerichtlichen
Rechtsprechung und in der Literatur unterschiedlich beurteilt.
Die herrschende Meinung sieht die Veranlassung des
Kreditkartenunternehmens zur Zahlung durch den Kreditkarteninhaber als
Weisung im Sinne der §§ 665, 675 Abs. 1 BGB an, die grundsätzlich
unwiderruflich ist, weil das Vertragsunternehmen mit der Unterzeichnung
des Belastungsbelegs aufgrund des Akquisitionsvertrags mit dem
Kreditkartenunternehmen einen irreversiblen Zahlungsanspruch erlange
(OLG Schleswig WM 1991, 453, 454; OLG München WM 1999, 2356, 2357; LG
Aachen WM 1994, 2158, 2160; LG Frankfurt/Main WM 1994, 111, 113; MünchKomm/Hadding,
HGB ZahlungsV Rdn. G 41; Martinek/Oechsler, in: Schimansky/Bunte/Lwowski,
Bankrechts-Handbuch 2. Aufl. § 67 Rdn. 35; Haun, in: Hellner/Steuer,
Bankrecht und Bankpraxis Rdn. 6/1937 ff.; Bitter ZBB 1996, 104, 113;
Oechsler WM 2000, 1613, 1618; jeweils m. w. Nachw.). Teilweise wird die
Weisung im Sinne der §§ 665, 675 Abs. 1 BGB als widerruflich angesehen,
solange das Kreditkartenunternehmen gegenüber dem Vertragsunternehmen nach
Maßgabe der Vertragsgestaltung zwischen diesen Parteien noch nicht
endgültig gebunden ist (LG Tübingen NJW-RR 1995, 746, 747;
Langenbucher, Die Risikozuweisung im bargeldlosen Zahlungsverkehr S.
274-276; vgl. auch Wolf EWiR 1991, 209 f.). Nach anderer Ansicht ist
die Unterzeichnung des Belastungsbelegs durch den Karteninhaber eine
Anweisung im Sinne des § 783 BGB, die mangels schriftlicher (§ 784 Abs. 2
Satz 1 BGB) Annahme bis zur Bewirkung der Leistung, d.h. bis zur Zahlung
an das Vertragsunternehmen, gemäß § 790 Satz 1 BGB widerruflich sei,
sofern nichts anderes vereinbart werde (OLG Frankfurt/Main WM 1994,
942; LG Berlin WM 1986, 1469, 1471; Canaris, Bankvertragsrecht 2. Aufl.
Rdn. 1624, 1634; offengelassen von OLG Karlsruhe WM 1991, 184, 187 f.).
bb) Der Senat teilt die herrschende Auffassung. Die
Unterzeichnung des Belastungsbelegs ist keine von den zugrunde liegenden
Schuldverhältnissen abstrakte (vgl. Martinek/Oechsler aaO § 67 Rdn. 33)
Anweisung im Sinne des § 783 BGB, sondern eine Weisung im Sinne der §§
665, 675 Abs. 1 BGB (BGHZ 91, 221, 224) im Rahmen des
Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen dem Kreditkartenherausgeber und dem
Kreditkarteninhaber und zugleich die Bedingung, mit deren Eintritt der
Anspruch des Vertragsunternehmens gegen das Kreditkartenunternehmen
aufgrund eines rahmenmäßig vereinbarten abstrakten Schuldversprechens
entsteht. Bereits mit der Unterzeichnung und Übergabe des
Belastungsbelegs durch den Karteninhaber, nicht erst mit dessen
Einreichung (ungenau insoweit Senat, Urteil vom 16. April 2002 - XI ZR
375/00, WM 2002, 1120, 1122, für
BGHZ vorgesehen), erwirbt das Vertragsunternehmen aufgrund des
Aquisitionsvertrages einen abstrakten Anspruch (§ 780 BGB) gegen das
Kartenunternehmen auf Ausgleich der im Verhältnis zwischen dem
Vertragsunternehmen und dem Karteninhaber begründeten Forderungen (Haun
aaO Rdn. 6/1940). Schon damit liegt eine irreversible
Vermögensdisposition des Kreditkartenunternehmens vor, die einen Widerruf
der Weisung ausschließt (Martinek/Oechsler, aaO § 67 Rdn. 35).
Etwaige Einwendungen, die das Kreditkartenunternehmen aufgrund des
Vertrages mit dem Vertragsunternehmen gegen dessen Zahlungsanspruch
erheben kann, können allenfalls für die Frage von Bedeutung sein, ob das
Kreditkartenunternehmen seine Zahlung an das Vertragsunternehmen, d.h. die
Aufwendung im Sinne des § 670 BGB, für erforderlich halten darf. Sie
rechtfertigen es aber nicht, den Anspruch des Vertragsunternehmens zur
Disposition des Karteninhabers zu stellen und von dessen Widerruf abhängig
zu machen. Die Kreditkarte kann die ihr von den Beteiligten zugewiesene
bargeldersetzende Funktion nur erfüllen, wenn der Anspruch, den das
Vertragsunternehmen gegen das Kreditkartenunternehmen erlangt, einer
Barzahlung wirtschaftlich gleichwertig ist (vgl.
Senat, Urteil vom 16.
April 2002 - XI ZR 375/00 aaO S. 1121).
Das ist nur dann der Fall, wenn die Weisung des Karteninhabers
unwiderruflich ist (OLG Schleswig WM 1991, 453, 454; Kümpel, Bank- und
Kapitalmarktrecht 2. Aufl. Rdn. 4.934; Pfeiffer, Kreditkartenvertrag, in:
Graf von Westphalen, Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke, Rdn. 68).
3. Die Zahlungen der Beklagten an das Vertragsunternehmen waren
Aufwendungen im Sinne der §§ 670, 675 Abs. 1 BGB, die sie den Umständen
nach für erforderlich halten durfte.
a) Wenn das Vertragsunternehmen ordnungsgemäße Belastungsbelege einreicht,
darf das Kreditkartenunternehmen die Zahlung an das Vertragsunternehmen
grundsätzlich für erforderlich halten, ohne zu prüfen, ob dem
Vertragsunternehmen eine wirksame Forderung gegen den Karteninhaber
zusteht. Diesbezügliche Reklamationen und Beanstandungen sind gemäß Nr. 9
der "Bedingungen für den EUROCARD-Service" zwischen Vertragsunternehmen
und Karteninhaber zu klären und berühren die Zahlungsverpflichtung des
Karteninhabers gegenüber der Beklagten nicht. Nr. 6 Abs. 2 Satz 1 der
"Bedingungen für die D.-Kreditkarten", derzufolge eine Erstattungspflicht
des Karteninhabers gegenüber der Beklagten nicht besteht, wenn eine
wirksame Forderung des Vertragsunternehmens nicht begründet wurde, ist
nach dem Vortrag des Klägers zwischen den Parteien nicht wirksam
vereinbart worden.
b) Die Zahlung des Kreditkartenunternehmens an das Vertragsunternehmen
ist allerdings ausnahmsweise dann keine Aufwendung, die das
Kreditkartenunternehmen für erforderlich halten darf, wenn das
Vertragsunternehmen das Kreditkartenunternehmen rechtsmißbräuchlich in
Anspruch nimmt (vgl. Senat, Urteil vom 16. April 2002 - XI ZR
375/00, aaO S. 1124). Dann ist
das Kreditkartenunternehmen zur Zahlungsverweigerung nicht nur berechtigt,
sondern aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages mit dem Karteninhaber
auch verpflichtet. Da das Vertragsunternehmen, wie dargelegt, mit der
Unterzeichnung des Belastungsbelegs durch den Karteninhaber einen
abstrakten Zahlungsanspruch aus § 780 BGB gegen das
Kreditkartenunternehmen erwirbt mit der Folge, daß diesem Anspruch -
ähnlich wie beim Akkreditiv - Einwendungen aus dem Valutaverhältnis -
vorbehaltlich abweichender vertraglicher Vereinbarungen, zu denen im
vorliegenden Fall nichts vorgetragen worden ist - nicht entgegengehalten
werden können, liegt eine rechtsmißbräuchliche Inanspruchnahme des
Kreditkartenunternehmens nur vor, wenn das Vertragsunternehmen seine
formale Rechtsposition ersichtlich treuwidrig ausnutzt. Das ist nur dann
der Fall, wenn offensichtlich oder liquide beweisbar ist, daß dem
Vertragsunternehmen eine Forderung aus dem Valutaverhältnis gegen den
Karteninhaber nicht zusteht (MünchKomm/Hadding, HGB ZahlungsV Rdn. G
29, 42; Martinek/ Oechsler aaO § 67 Rdn. 37; Pfeiffer aaO Rdn. 69; Kümpel
aaO Rdn. 4.942; Haun aaO Rdn. 6/1953 f.; Taupitz, Zahlung mittels
Kreditkarten, in: Hadding/Hopt/Schimansky, Bankrechtstag 1998, S. 3, 12;
Bitter ZBB 1996, 104, 113; Oechsler WM 2000, 1613, 1617; s. auch LG
Frankfurt/Main WM 1994, 111, 113). Davon kann hier indes keine Rede
sein.
aa) Der Kläger hat der Beklagten zur Unwirksamkeit des Valutaverhältnisses
nach § 105 Abs. 2 BGB am 20. November 1998 lediglich mitgeteilt, er sei
bei Unterzeichnung der Belastungsbelege "sturzbetrunken" und nicht Herr
seiner Sinne gewesen. Beweismittel hat er der Beklagten dafür weder
übergeben noch benannt. Unter diesen Umständen konnte die Beklagte die
Nichtigkeit des Valutaverhältnisses gemäß § 105 Abs. 2 BGB gegenüber dem
Vertragsunternehmen nicht einmal substantiiert behaupten, geschweige denn
ohne weiteres beweisen.
bb) Zur angeblichen Sittenwidrigkeit des Valutaverhältnisses hat der
Kläger der Beklagten vor Zahlung an das Vertragsunternehmen ohne Benennung
von Beweismitteln lediglich mitgeteilt, es gebe Belastungsbelege zugunsten
eines Nachtlokals über 18.000 DM, er sei insoweit betrogen worden und
wolle Strafanzeige erstatten. Daß die Beklagte aufgrund dieses
unsubstantiierten, nicht einmal schriftlich niedergelegten Vorbringens des
Klägers nicht gehalten war, einen Ausgleich der ordnungsgemäßen
Belastungslege zu verweigern und es gegebenenfalls auf einen Rechtsstreit
mit dem Vertragsunternehmen ankommen zu lassen, liegt auf der Hand.
4. Ob dem Karteninhaber, wie das Berufungsgericht erwogen hat,
gegenüber dem Aufwendungsersatzanspruch des Kreditkartenunternehmens nach
Ausgleich des Belastungsbelegs ein Leistungsverweigerungsrecht zustehen
kann, wenn dem Kreditkartenunternehmen nachträglich Umstände bekannt
werden, die einen Rückforderungsanspruch gegenüber dem Vertragsunternehmen
begründen können, erscheint zweifelhaft, weil dem Karteninhaber im Falle
der Unwirksamkeit des Grundgeschäfts ein eigener Anspruch gegen das
Vertragsunternehmen auf Mitwirkung bei der Stornierung der
Belastungsbuchung durch das Kreditkartenunternehmen zusteht (Pfeiffer
aaO Rdn. 84). Dabei kann der Karteninhaber anders als das
Kreditkartenunternehmen, das auch im Rückforderungsprozeß gegen das
Vertragsunternehmen nach Ausgleich des Belastungsbelegs, vorbehaltlich
einer anderweitigen vertraglichen Regelung, auf offensichtliche oder
liquide beweisbare Einwendungen aus dem Valutaverhältnis beschränkt ist
(vgl. MünchKomm/Hadding, HGB ZahlungsV Rdn. G 29 a.E.), alle Einwendungen
aus dem Valutaverhältnis ohne eine solche Einschränkung geltend machen.
Die angesprochene Frage bedarf hier indes keiner abschließenden
Entscheidung. Jedenfalls ist es dem Karteninhaber verwehrt, das
Kreditkartenunternehmen nach Ausgleich ordnungsgemäß unterzeichneter
Belastungsbelege auf einen etwaigen Rückforderungsanspruch gegen das
Vertragsunternehmen zu verweisen, wenn er es - wie hier - vor Begleichung
der Belastungsbelege versäumt hat, das Kreditkartenunternehmen in die Lage
zu versetzen, offensichtliche oder liquide beweisbare Einwendungen gegen
die Forderung des Vertragsunternehmens aus dem Valutaverhältnis zu
erheben.
III.
Die Revision des Klägers war daher als unbegründet zurückzuweisen.
|